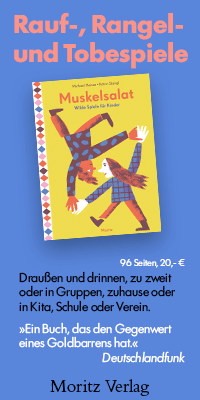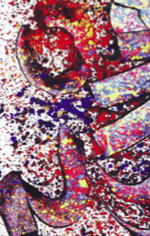 |
Bevor ich die Geschichte eines Kindes aus einer Kita Deutschlands erzähle, möchte ich sicherheitshalber auf eine bekannte Formel zurückgreifen: Auftauchende Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen sind unbeabsichtigt und rein zufällig. Falls sie sich dennoch einstellen, könnten sie dazu dienen, sich baldmöglichst folgende Fragen zu stellen:
• Woran erinnert mich diese Geschichte?
• Wozu fordert mich die Erinnerung auf?
• An welcher Stelle der Geschichte würde ich aus heutiger Sicht etwas anders machen?
• Welche konstruktive Wende könnte die Geschichte nach dieser Veränderung nehmen?
Außerdem sei darauf hingewiesen: Ich erzähle die Geschichte als Beobachter und deshalb subjektiv.
Die Geschichte handelt von einem Kind, das regelmäßig in die Kita geht. Die Erzieherinnen erlebten es bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Geschichte beginnt, als ein ruhiges, eher zurückgezogenes Kind. Manchmal machte es einen traurigen Eindruck und wollte sich dann nicht an den Spielen der anderen Kinder beteiligen.
Vielleicht war es wachsendes Vertrauen zu den Kolleginnen, das das Kind eines Tages bewog, ein anderes Bild von sich zu zeigen. Es wurde aggressiv gegenüber anderen Kindern und erzählte von Gewaltsituationen zu Hause. Den Kolleginnen wurde mulmig, und sie luden die Mutter zum Gespräch.
Im Gespräch machte die Mutter einen verschüchterten Eindruck, widersprach aber den Gewaltbeschreibungen ihres Kindes nicht und erzählte von einem übergriffigen Vater, dem auch ihr gegenüber schon mal »die Hand ausgerutscht« sei. Damit hätte er aber meist Recht gehabt, meinte sie. Er komme aus einer anderen Kultur, und da sei man der Frau gegenüber halt strenger. Sie erzählte auch, dass sie ihr Kind nicht mehr »lenken« könne, es gehorche ihr nicht.
Die Kolleginnen waren über diese Aussagen und den leidenden Eindruck entsetzt, den die Mutter auf sie machte. Auf die Frage, ob ihr Kind auch manchmal geschlagen würde, antwortete sie zögerlich mit: »Manchmal fällt mir nichts Besseres mehr ein…« Die Zusammenkunft endete mit der Bitte, das Kind nicht mehr zu schlagen, und dem Angebot weiterer unterstützender Gespräche.
In der Folgezeit verhielt sich das Kind nicht so, dass die Kolleginnen den Eindruck gewinnen konnten, es bessere sich etwas. Seine Aggressionen eskalierten immer weiter, und eines Tages sagte es: »Ich werde mich töten.« Diese Aussage, sie tauchte wiederholt auf, hatte unterschiedliche Auswirkungen auf die Menschen in der Kita:
Die anderen Kinder fragten, warum das Kind so etwas sagt.
Zwei Kolleginnen fühlten sich persönlich betroffen, weil sie mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert wurden.
Eine Mutter, die zufällig miterlebte, was das Kind äußerte, wollte den Elternbeirat einberufen und erklärte: »Sollte da nicht sofort etwas passieren, werde ich die Polizei informieren.«
Die Leiterin fühlte sich überfordert von der Situation und hatte große Angst, dass das Kind sich tatsächlich etwas antun könnte. Es hatte gedroht, vor ein Auto zu laufen, damit es überfahren werde.
Mit einer hinzugezogenen Trägervertreterin beschloss das Leitungsteam, das Jugendamt zu informieren, und erhofften sich davon die nötige professionelle und personelle Unterstützung, um dem Kind helfen und seine Familie mit dieser Geschichte konfrontieren zu können.
Das Jugendamt schickte, relativ zeitnah, einen Kinder- und Jugendpsychiater in die Kita, der ein Gespräch mit dem Kind führte. Dieses Gespräch dauerte eine Viertelstunde und ergab: Das Kind ist nicht suizidgefährdet; akuter Handlungsbedarf besteht nicht. An dieser Einschätzung änderten auch die Informationen, die die Erzieherinnen über das Kind lieferten, nichts. Das Jugendamt sicherte jedoch zu, mit den Eltern Kontakt aufzunehmen.
Die Unterstützungsmaßnahme in der Kita wurde beendet – zurück blieben zwei betroffene Erzieherinnen, aufgewühlte Kinder und allein gelassene Kita-Pädagoginnen, die nun versuchen mussten, mit dieser Geschichte fertig zu werden: Sollten sie unter dem Damokles-Schwert der Suizidandrohung weiterarbeiten wie bisher? Sollten sie das Kind nach Hause schicken, um das Problem von den anderen Kindern fernzuhalten? (Auch diese Variante habe ich schon erlebt…)
So ähnlich mag sich die Geschichte abgespielt haben. Genau weiß ich es nicht, denn ich habe sie aus wenigen Informationen konstruiert und erzähle sie – wie schon gesagt – aus meiner subjektiven Sicht heraus. Es könnte sich alles auch ganz anders abgespielt haben...
Man stelle sich vor, sie sei in einer systemisch organisierten Kita passiert. Was könnte dann anders gelaufen sein?
Die Aussage des Kindes wird sofort ernst genommen und – ebenso wie sein Verhalten – dokumentiert. Außerdem ist klar: Der Notplan »Kindeswohl-Gefährdung«, über den das Team verfügt, tritt in Kraft. Er sieht vor:
• Die Leitung informieren.
• Ein Fallgespräch mit dem Ziel führen, eine Strategie zu entwerfen, an der alle Beteiligten partizipieren können. Das Setting im Besprechungswesen wird auf die aktuelle Krise eingestellt.
• Die Eltern des Kindes werden in vertraulichen Gesprächen über die Möglichkeiten informiert, die die Kita hat, und die Kolleginnen bekommen die volle Unterstützung der Leitung, um ihre Betroffenheit aufzuarbeiten. Falls nötig, wird eine Supervision beantragt.
• Andere Dienste werden einbezogen, wenn Überforderung droht. Das ist bei der angekündigten Selbstgefährdung gegeben.
• Detaillierte Dokumentation im pädagogischen Alltag ist nötig: Verlauf beim Kind, Elterngespräche, Kontaktgespräche mit anderen Stellen…
Folgende Strategie würde ein systemisch arbeitendes Team sofort mit dem Kind und der Familie eingeschlagen:
• Der Träger wird kontinuierlich informiert.
• Der interne Psychologe wird einbezogen, um mit dem Kind eine Einzelmaßnahme zu beginnen.
• Die Eltern werden zu regelmäßigen Gesprächen mit der systemisch geschulten Leitungskraft eingeladen. Es finden familientherapeutisch orientierte Gespräche statt.
• Die Kollegin, die für das Kind zuständig ist, wird, wo es möglich ist, von anderen Aufgaben entlastet, um die Beziehung mit dem Kind zu intensivieren.
• Ein Mal pro Woche wird ein Kontrollgespräch der beteiligten Personen durchgeführt.
• Es wird kontinuierlich bei der zuständigen behördlichen Stelle über weitere Eskalationen berichtet, um die Verantwortung an die Stelle zu transportieren, an die sie gehört.
Aus meiner Sicht könnte ein auf solche Weise arbeitendes Team hilfreich wirken, wenn es dem Kind mutig zur Seite steht. Darüber hinaus kann eine Fachkraft für systemische Therapie mit Kindern und Jugendlichen, die fest in der Kita angestellt ist, hilfreich wirken. Sie kann in der Notsituation ein anderes standing gegenüber den amtlichen Stellen aufbauen und im weiteren Verlauf die therapeutische Seite besetzen oder die Kooperation mit dem Psychologen koordinieren.
Trotzdem soll nicht der Eindruck entstehen, dass ich die beschriebene Kompetenzverteilung für die einzig sinnvolle halte. Und: Für die Kolleginnen oder Kollegen aus dem Amt besteht kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen, nach dem Motto: »Warum die Aufregung – es läuft doch alles…«
Ich meine, dass man Hilfestellung im Sinne von Humanismus und Solidarität von jedem Menschen erwarten kann, und angesichts des Todeswunsches eines Kindes verbietet sich die Art von Leichtsinn gänzlich, die der Kinder- und Jugendpsychiater in meiner Geschichte an den Tag legte. Wenn ein Kind seinen Erzieherinnen nach Monaten der Vertrauensbildung erzählen kann, welche Not es erleidet, wird es dies gegenüber einem fremden Menschen in einem viertelstündlichen Gespräch ganz gewiss nicht tun. Zu oft werden Kinder nicht ernst genommen, zu oft wird den Berichten der Kolleginnen aus der Kita kein Glauben geschenkt. Im Gegenteil – die hochwertige Arbeit in den Einrichtungen wird immer wieder herabwürdigend übergangen.
Warum werden Kita-Teams nicht ernst genommen und in das Netzwerk der Hilfeleistungen gleichberechtigt eingebaut? Warum werden sie nicht zu Erziehungskonferenzen eingeladen? Warum können sie selbst solche Konferenzen nicht einberufen? Warum gibt es – über das bloße Kontakt-Aufnehmen hinaus – keine Handlungsverpflichtung für die behördlichen Stellen in Fällen der Kindeswohlgefährdung? Reichen die Fälle der letzten Monate nicht aus? Wie viele Kinder sollen noch sterben?
Meine Bitte: Nicht wegschauen, Augen und Ohren nicht verschließen, sondern – wie die Kolleginnen in der Geschichte – nichts unversucht lassen. Schließlich geht es um ein Menschenleben.
Harald Ott-Hackmann
Harald Ott-Hackmann ist Systemischer Lehrtherapeut, Supervisor und Organisationsberater des Hamburger PPSB und der Systemischen Gesellschaft.
Kontakt:
PPSB
Max-Brauer-Allee 100
22765 Hamburg
Tel: 040/390 47 84
www.ppsb-hamburg.de