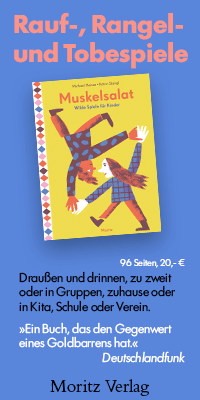|
Seit mehr als 50 Jahren wird über »Begabung« gestritten. Dabei steht außer Frage, dass sich Menschen sich in ihren Kompetenzen und auch in ihren Lernprozessen unterscheiden. Bereits im Säuglings- und Kleinkindalter zeigen manche Kinder bestimmte Fähigkeiten in besonderer Weise oder entwickeln sie früher als Andere. Der Streit um den Begabungsbegriff beginnt erst, wenn es um die Frage geht, woher denn Begabung kommt. Ein Beitrag von Prof. Dr. Holger Brandes, Prorektor an der Evangelischen Hochschule in Dresden.
Im Alltagsverständnis wird Begabung fast immer im Sinne einer »angeborenen« und – seitdem die Vererbungslehre und die Rolle von Genen als Träger der Erbsubstanz zum Allgemeinwissen geworden sind – als genetisch bedingte Lernvoraussetzung gedacht. Der simpel konstruierte Zusammenhang ist dabei der von einem Gen zu einer besonderen Begabung, was dann zu Aussagen führen kann wie beispielsweise: »Das Fußball-Gen liegt in der Familie«1 oder »Jeder Sachse trägt ein Ingenieur-Gen in sich«.2
In wissenschaftlichen Zusammenhängen sind Aussagen zur genetischen Bedingtheit beispielsweise von bestimmten körperlichen Erkrankungen inzwischen gut belegt, offenbar gibt es hier einen im Prinzip ebenso deutlichen genetischen Faktor wie bei Haarfarbe oder Hauttyp. Schwieriger und strittiger sind diesbezügliche Aussagen aber bei Verhaltensqualitäten und psychischen Kompetenzen. Hier beruhen Aussagen zur genetischen Beeinflussung bis heute in erster Linie auf Ergebnissen der Zwillingsforschung. So wird beispielsweise der genetische Einfluss auf getestete Intelligenzleistungen mit Ergebnissen der Zwillingsforschung begründet, die bei eineiigen Zwillingen (EZ mit 100 Prozent gleicher Erbanlage) höhere Übereinstimmungen findet als bei zweieiigen Zwillingen oder Geschwistern (mit geschätzt 50 Prozent gleicher Erbanlage).
Inwieweit diese Ergebnisse aber tatsächlich einen genetischen Faktor abbilden und die Aussage rechtfertigen, dass Intelligenz zu 50 Prozent oder mehr vererbt sei, ist zumindest sehr umstritten. Hierzu hat auch die Gehirnforschung beigetragen, die belegt, dass die strukturelle Reifung des Gehirns sich in einem »erfahrungsbedingten Selektionsprozess« entwickelt und schon vor der Geburt durch Sinnessignale und damit Umwelteinflüsse beeinflusst wird. »Angeboren« ist demnach nicht mit »genetisch bedingt« gleichzusetzen. Noch gravierender ist die Schwierigkeit, Unterschiede im Umwelteinfluss beispielsweise auf EZ und auf Geschwister zu kontrollieren. Bekanntermaßen tendieren viele Eltern dazu, EZ in hohem Maße »gleich« zu behandeln, was natürlich nicht ohne Einfluss auf deren individuelle Entwicklung ist. Zwar wurde durch die Gegenüberstellung von gemeinsam und von getrennt aufgewachsenen eineiigen Zwillingspaaren versucht, diesem Einwand zu begegnen, aber gerade bezogen auf diese Vergleiche sind die Ergebnisse (wegen der geringen Zahl bereits früh getrennt aufgewachsener Zwillinge) wenig belastbar.
Deshalb hat man in den letzten Jahren große Hoffnungen in die Genforschung gesetzt. Insbesondere seit in den 1990er Jahren die Entschlüsselung des menschlichen Genoms gelungen ist und man die Abfolge der Basenpaare der menschlichen DNA identifizieren konnte, wuchs die Erwartung, Gensequenzen zu finden, die man unmittelbar mit Verhaltensqualitäten bzw. Intelligenz in Zusammenhang bringen kann. Hiermit sind verschiedene Forschergruppen inzwischen seit gut zehn Jahren beschäftigt.3 Der Aufwand dieser Forschung ist immens, weil die DNA einer großen Zahl von Personen bezogen auf hundertausende von genetischen Abweichungen (genetische Marker oder SNIPs) mit bestimmten Merkmalen der Personen verglichen werden müssen. Bezogen auf körperliche Merkmale und somatische Erkrankungen sind diese Forschungen Erfolg versprechend, aber bezogen auf Zusammenhänge mit geistigen Fähigkeiten sind die bisherigen Ergebnisse eher ernüchternd.
Bezogen auf die genetische Beeinflussung von Intelligenz bzw. allgemein geistigen Leistungen sind die aufwendigsten Untersuchungen von einer Londoner Forschergruppe um Robert Plomin durchgeführt worden. Dabei wurden auf Grundlage der DNA von fast 8.000 siebenjährigen Kindern über 350.000 dieser genetischen Marker (SNPs) auf den Zusammenhang zu geistigen Leistungsfähigkeiten untersucht. Auf dem letzten (veröffentlichten) Forschungsstand4 hat man zwar inzwischen neun Genregionen gefunden, die statistisch erfassbare Zusammenhänge mit geistiger Leistungsfähigkeit aufweisen, aber alle zusammen erklären lediglich ca. 1,2 Prozent der individuellen kognitiven Unterschiede zwischen den Kindern. Das ist nicht annähernd das, was die Autoren aufgrund ihrer eigenen Zwillingsforschungen angenommen hatten – Plomin selbst war bisher von 50 bis 55 Prozent erblicher Beeinflussung allgemeiner kognitiver Fähigkeit ausgegangen.5
Folglich müssen sie zugestehen: »Unsere Studie hat keine starken Zusammenhänge zwischen genetischen Variationen und kindlichen kognitiven Fähigkeiten feststellen können.«6 Entsprechend fällt auch das Resümee von Edmund Sonuga-Barke aus, dessen amerikanische Forschungsgruppe solche Analysen in Hinblick auf psychische Störungsbilder (wie ADHS) vorgenommen hat. Er stellt fest, dass »selbst die umfassendsten verfügbaren Untersuchungen des gesamten Genoms, mit tausenden von Patienten unter Verwendung von hunderttausenden von genetischen Markern nur eine relativ kleine Zahl von psychischen Krankheitsbildern erklären können«7.
Je mehr die Genforschung also in der Lage ist, in die Feinstrukturen des Erbgutes einzudringen, desto schwächer werden offensichtlich die nachweisbaren Effekte von genetischen Unterschieden auf geistige Leistungen. Plomins Forschergruppe empfiehlt deshalb, sich bezogen auf geistige Fähigkeiten von der Erwartung großer Effekte identifizierbarer Genregionen zu verabschieden und sieht sich nur noch auf der »Jagd nach den kleinen Effekten« (Hunting the small effects).
Dennoch sind diese Forschungen hilfreich, um unser Bild von der Entstehung von Begabung konkreter werden zu lassen. Auf dem aktuellen Stand ist zumindest eines ganz klar: Es gibt keinen relevanten direkten Zusammenhang zwischen einzelnen Genen oder Gensequenzen mit geistigen Fähigkeiten oder bestimmten Verhaltensmerkmalen. Das Intelligenz-Gen gibt es ebenso wenig wie ein Mathematik-, Fußball- oder Ingenieur-Gen. Bestenfalls setzt sich der erbliche Anteil aus vielen minimalen Beiträgen einer großen Zahl von Genen zusammen und auch hier ist der bislang nachgewiesene Effekt sehr begrenzt und mit um 1 Prozent weit von bisherigen Spekulationen über den Erbeinfluss bei geistigen Fähigkeiten entfernt. Darüber hinaus unterstützen die bisherigen Ergebnisse die Annahme, dass Gene und Umwelt von Anbeginn an bei der Hervorbringung neuronaler Entwicklung zusammen arbeiten. Aus Sicht des Genforschers Sonuga-Barke heißt das: »Es ist die Umwelt – wie dumm«. Und er folgert hieraus, dass sich »ernsthafte Wissenschaft jetzt mehr denn je auf die Macht der Umwelt bei der Hervorbringung neuronaler Entwicklungsprozesse konzentrieren« müsse.8
Alles in Allem bestätigt die aufwendige Genforschung der letzten zehn Jahre, was Wolf Singer, Direktor des MPI für Hirnforschung in Frankfurt, schon zu Anfang prognostiziert hat: »Es gibt fast keine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen genetischen Instruktionen und bestimmten Eigenschaften, schon gar nicht im Bereich von Begabungsperspektiven und Persönlichkeitsmerkmalen«.9
1 So die österreichische »Kline Zeitung« am 4.11.2010 zur Familie Beckham. Anlass sind die Fußballkünste der beiden Söhne, die Vater David mit den Worten kommentiert: »Sie haben wirklich die exakt gleiche Haltung wie ich, wenn sie den Ball schießen, das ist fast unheimlich«.
2 So der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich hinsichtlich der starken sächsischen Tradition in der Ingenieurbildung; zit.n. Sächs. Zeitung vom 6.11.2010.
3 Da 99,9 Prozent unseres Erbguts bei allen Menschen identisch sind, konzentriert man sich hierbei auf die verbleibenden 0,1 Prozent. Dieses sind zufällig über das gesamte Genom (die gesamte Genstruktur eines Menschen) verteilte und vererbbare Abweichungen einzelner Bausteine (Basenpaare), die als SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) bezeichnet und als »genetische Marker« benutzt werden. Einige hunderttausend dieser SNIPs sind bereits identifiziert, man nimmt aber an, dass wesentlich mehr solcher Variationen im menschlichen Erbgut versteckt sind, wobei der größte Teil aber keine Auswirkungen hat.
4 Vgl. Davis, O., Butcher, L., Docherty, S., Meaburn, E., Curtis, C., Simpson, M., Schalkwyk, L., Plomin, R. (2010): A Three-Stage Genome-Wide Association Study of General Cognitive Ability: Hunting the Small Effects. In: Behavior Genetics, 40, S. 759-767
5 Vgl. Plomin, R., DeFries, J., McClearn, G. & McGuffin, P. (2001): Behavioral Genetics (4. Aufl.), New York: Freeman
6 Davis et al., S. 764
7 Sonuga-Barke, E. (2010): Editorial: »It’s the environment stupid!« On epigenetics, programming and plasticity in child mental health. In: Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, S. 113
8 ebenda
9 Singer, W. (2002): Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 44
Der besondere Lesetipp:
Koop, C., Schenker, I., Müller, G., Welzien, S., Karg-Stiftung (Hrsg.):
Begabung wagen
Ein Handbuch für den Umgang mit Hochbegabung in Kindertagesstätten
verlag das netz, Weimar/Berlin 2010
416 Seiten, mit Fotos
ISBN 978-3-86892-037-6
Euro 29,90
Im Shop bestellen
Den vollständigen Beitrag können Sie in unserer Ausgabe Betrifft KINDER 08-09/11 lesen.